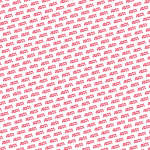IM DREHZAHLBEGRENZER MIT ... HERBERT AMPFERER - WELTEN WANDLER







Ihr Weg zu Porsche war etwas ungewöhnlich. Nehmen Sie uns mit zu den Anfängen …
Ich war in einem Lokal in Stockholm, das „Schwarze Katze“ hieß. Ich hatte nach meinem Maschinenbaustudium in Steyr einen Job in Schweden angenommen, um nicht zum Militär zu müssen. Wir saßen also da, es gab Gösser-Bier und Bockwürste mit Kartoffelsalat. Ein anderer ehemaliger Student fragte mich: „Willst nicht zum Porsche kommen?“ BMW kannte ich, aber von Porsche hatte ich noch nie gehört. Ich dachte mir: Warum nicht? Vom Wirt habe ich mir einen Stift und einen Block geliehen – das war meine Bewerbung.
Ein anderer Student fragte: „Willst nicht zum Porsche kommen?“ BMW kannte ich, aber von Porsche hatte ich noch nie gehört
Und die war offenbar überzeugend …
Auf der nächsten Heimreise, mit einem Koffer voller schmutziger Wäsche, habe ich in Stuttgart Station gemacht. Das war an einem Freitag. Am Montagmorgen habe ich angefangen. Dank meiner Mutter mit frischen Sachen. Arbeitsbeginn mitten im Monat, am 14. September 1970. Ich bin 45 Jahre und drei Monate geblieben.
Wie war die Stimmung damals bei Porsche?
Sehr geschäftig. Da herrschte Aufbruch. Ich dachte, ich komme in eine ganz fremde Welt. Aber in der Motorenkonstruktion bei Porsche arbeiteten 20 Mann, zehn waren Österreicher. Wir saßen im alten Backsteinbau in Werk 1 in einem komplett offenen Büro. Es gab zwei Gruppen unter den Konstrukteuren. Die eine hat den 911 gemacht, der Rest die anderen Projekte. Zu der gehörte ich.
Was war das erste Projekt?
Zunächst bin ich beim 924 gelandet. Damals gab es bei uns schon die ersten Diskussionen zu Wasserkühlung und Luftkühlung. Das Thema sollte mich meine ganze Karriere über nicht mehr loslassen. Mein zweites großes Projekt war der Mittelmotor EA 266 für einen VW-Kleinwagen. Zum Einstieg war das unglaublich spannend. Ich habe zum ersten Mal realisiert, wie komplex ein Automobil ist. Beinahe naiv habe ich meinen Freund, der mich zu Porsche geholt hatte, gefragt: „Müssen etwa all die Teile konstruiert werden?“ Der hat mich nur mit großen Augen angeguckt. Ich habe zum ersten Mal begriffen, welchen Beruf ich als Konstrukteur ergriffen habe.
Mit dem Turbomotor für den 911 stand Ihre erste große Bewährungsprobe an …
Der Abteilungsleiter kam zu mir mit den Worten: „Ich habe ein Attentat auf Sie vor.“ Ich war zunächst fassungslos. Hans Mezger hatte ja den Ruf als Motorenpapst und beschäftigte sich im Motorsport schon mit dem 917 und der Turbotechnik. Wir aus der Serienkonstruktion hatten aber ganz andere Anforderungen. Damals habe ich nicht ahnen können, wie sehr die Rennerei mich selbst noch beschäftigen würde. Für den 930 habe ich mich erst mal umgeguckt: Was machen denn die anderen so? Das einzige Straßenfahrzeug mit Turbotechnik war ein Ford Capri vom Tuner Michael May. So einer wurde gekauft, damit unser Team ihn auseinandernehmen konnte. Ich wollte ihn Probe fahren, ganz vorsichtig. Doch plötzlich machte der Capri einen Riesensatz und ich wäre in der Nähe von Weissach fast an einer Friedhofsmauer zerschellt. Ich hatte großes Glück. Vor allem aber einen wichtigen Hinweis für unsere Arbeit bekommen – das Turboloch hatte mich erwischt.
Der 930 wurde also unter Lebensgefahr geboren?
Um den 911 Turbo fahrbar zu machen, haben wir eine K-Jetronic für die mechanische Einspritzung installiert. Es musste ja auch bezahlbar sein. Um den bestehenden Rumpfmotor herum habe ich das komplette Konzept neu gemacht. Vom Wärmetauscher über die Sammelrohre zum Turbolader, vom Turbolader zum Auspuff, ein Wastegate eingebaut, die Ladedruckregelung und dann die Druck- und die Saugleitung. Fast hätten wir eine Thematik vergessen: Was machen wir mit dem Öl, das vom Turbolader zurückläuft? Ich musste noch einen Catch Tank, so einen Trockensumpf, konstruieren.
Der Turbo wurde zu einer Ikone …
Ich war sehr stolz, dass das Urkonzept des 930 so gut funktioniert hat und auf meinem Mist gewachsen ist. Zum ersten Mal habe ich den Zauber gespürt, ein weißes Blatt Papier mit eigenen Ideen zu füllen. Ich habe die ganzen externen Projekte verantwortet und bin in der Welt herumgekommen. Weil die Berechnungsabteilung manchmal zu wenig Zeit für mich hatte, habe ich mir in der Freizeit meine eigenen Rechenprogramme geschrieben.
Das klingt nach viel Leidenschaft. Lassen Sie uns in das Gehirn eines Konstrukteurs blicken?
Es ist ein Hirn, das sich ständig mit neuen Problematiken auseinandersetzt. Ich habe bei Porsche vom Einzylinder bis zum Zwölfzylinder alles gemacht. Manchmal habe ich am Frühstückstisch spontan etwas aufgemalt, bin aufgesprungen und habe nur zu meiner Frau gesagt: „Ich muss zum Hermann.“ Das war unserer Patentmann. Denn jeder Konstrukteur, der eine Eingebung hat, fragt sich natürlich, ob da schon mal jemand anderes daraufgekommen ist. So haben wir 30 bis 40 Patente für Porsche angemeldet. Als Erfinder habe ich einen finanziellen Anteil bekommen.
War diese Zeit als Erfinder die, die Sie am meisten erfüllt hat?
Es war die beste Lehrzeit. Ich habe einen sensationellen Überblick über den Motorenbau bekommen. Das hat mir immer wieder geholfen. Zum Beispiel, als es Ende der Achtziger um das Projekt 989 ging, den Viertürer. Ich war derjenige, der in Sachen Wasserkühlung wortwörtlich mit allen Wassern gewaschen war. Ein V8-Motor, vier Ventile, Querstromkühlung, Rädertrieb auf der Rückseite vom Motor – das hat sich für mich alles gefügt.
Hat das mit Ihrer Entdeckermentalität als Ingenieur zu tun?
Ich habe immer versucht, mich nicht nur in das System, an dem ich gerade arbeite, einzuarbeiten, sondern im Extremfall in das einzelne Bauteil. So tief, dass ich mich als Bauteil gefühlt habe. Wenn es um ein Pleuel ging, dann war ich das Pleuel. Und habe jede Umdrehung selbst gespürt.
Als Sie Chef der Motorenabteilung wurden, stellte sich die Philosophiefrage.
Die Abteilung war immer klar auf Kurs Luftkühlung gewesen. Aber ich hatte schon immer dagegen gestichelt. Wir hatten auch schon mit wassergekühlten Prototypen experimentiert. Die liefen auch. So ist 1996 ein Vorläuferprojekt für den späteren Paradigmenwechsel mit dem 996 entstanden. Keine einfache Geburt, aber eine erfolgreiche. Der Luftgekühlte war am Ende seiner Lebenszeit.
Wie kommt ein überzeugter Serienkonstrukteur zum Motorsport?
Als das Formel-1-Projekt mit Footwork 1991 überhaupt nicht lief, sollte ich im Auftrag des Vorstands eine Analyse machen. Alle wussten, dass das Auto und der Zwölfzylinder eine Katastrophe waren. Porsche hatte sich deshalb im Frühjahr mit dem Plan zurückgezogen, im Oktober, neu aufgestellt, zurückzukommen. Das sollte ich auf Machbarkeit prüfen. Schnell kam ich zu dem Schluss: Lasst die Finger davon. Das war eine echte Bombe, die ich da losgelassen hatte. Das Projekt wurde eingestellt. Und damit habe ich den Fuß im Motorsport gehabt. Sehr zum Leidwesen meiner Frau.
Was waren Ihre ersten Projekte im Motorsport?
Horst Marchart, der damalige Entwicklungsvorstand, hat gesagt: „Bauen Sie den Porsche-Motorsport wieder auf.“ Da war ja fast nichts mehr übrig. Hans Mezger ging. Und wir brauchten neue Autos, neue Motoren, neue Rennserien. Ich bin mit Norbert Singer in der Motorsportwelt herumgezogen. Der Weg führte natürlich nach Le Mans – zum mächtigen Alain Bertaut, einem der Verantwortlichen beim ACO. Damals herrschten in Le Mans magere Zeiten. Es waren zu kleine Starterfelder und zu wenige Werke. Wir haben einen Deal gemacht, um uns gegenseitig wiederzubeleben. Unsere Idee war eine Dreiteilung: eine Klasse für Werkssport, eine für gute Kundenteams und eine für Breitensportler. Das war ein Win-win für alle. Nur dass wir damals selbst noch keine passenden Rennwagen hatten.
Ich habe immer versucht, mich in das jeweilige Bauteil einzuarbeiten. Wenn es um das Pleuel ging, dann war ich das Pleuel
Und wie haben Sie den 911 passend dafür gemacht?
Damals waren von Tunern Motoren im Einsatz, die angeblich 380 PS hatten. Auf unseren Prüfständen haben wir schnell gemerkt, dass da viel gelogen wurde. Außerdem war der luftgekühlte Motor nicht zukunftsfähig und ich hatte ja den Auftrag, den Motorsport der Zukunft zu konzipieren. Deshalb haben wir zu Beginn der 90er-Jahre schon sehr frühzeitig den 996, der damals schon in der Entwicklung war, einbezogen. Für Rennen war der natürlich nicht geeignet und uns lief die Zeit davon. Ich habe dem Vorstand dann in die Hand versprochen, dass wir binnen drei Monaten etwas Renntaugliches auf die Beine stellen.
Wie ging das denn?
Wir haben das Kurbelgehäuse vom Elfer genommen, an das Kurbelgehäuse ein Zwischengehäuse eingesetzt, in das Zwischengehäuse oben aufgehängte nasse Wasserbüchsen und haben auf das Zwischenteil Vierventil-Zylinderköpfe draufgemacht. Am Motorende hat der originale Kettentrieb vom 959 reingepasst, Drehschwingungstilger und Schwungrad vorne haben wir selbst konstruiert und natürlich einen Öltank dazu. Den gab es ja nicht. Wir haben die 59 Millimeter Platz vor der rechten Zylinderbank ausgenutzt, um einen schmalen, senkrecht stehenden Öltank einzubauen. Der Vorstand konnte das erst kaum glauben, aber dann hatten wir ein neues Projekt an der Backe – auf Basis unseres Konzepts Motoren und Fahrzeuge für alle GT-Kategorien zu entwickeln. Das Problem war: Wir mussten für die Homologation Straßenautos davon bauen. Allein 100 für die GT3, 25 für die GT2 und mindestens eins für die GT1. Bis heute sind daraus Zigtausende Exemplare geworden. Wir haben nicht nur den Motorsport neu aufgebaut, sondern ein neues Geschäftsmodell erfunden. Wir haben nach Asien und Amerika exportiert, samt der Markenpokale – immer mit dem gleichen Motor. Auch die Straßenversionen haben ihn übernommen.
Waren das die goldenen Zeiten?
Komplett andere Zeiten. Ich glaube kaum, dass heute ein Ingenieur einfach den Vorstandsflieger kapern kann, um einen Motor samt Getriebe nach Barcelona zu bringen. Die Leine ist heute sicher viel, viel kürzer. Der ehemalige Porsche-Chefingenieur Paul Hensler hat uns gelehrt: Macht’s, wie ihr wollt, aber macht’s. Das war unsere große Freiheit.
Alle kennen den Begriff Mezger-Motor. Gab es in Ihrer Karriere einen Ampferer-Motor?
Heute kann ich ja darüber sprechen: 1991 – nach dem Formel-1-Desaster – haben wir eine Vorentwicklung für den McLaren-Rennstall betrieben, der ja mit Porsche große Zeiten erlebt hatte. Alles so geheim, dass die Kommunikation nachts über Fax lief. Die Geräte waren damals teuer, aber ich hatte eins bei mir zu Hause. Alle zehn Minuten hat unser Hund gebellt, wenn die Maschine wieder Konstruktionszeichnungen ausgespuckt hatte. Entstanden ist so ein Zehnzylinder mit 3,5 Litern Hubraum mit 850 PS, der in der Drehzahl jenseits der 15.000 lag. Mehr konnten unsere Prüfstände damals nicht leisten.
Eingesetzt worden ist er aber leider nie ...
... aber wieder zum Leben erweckt worden, als Porsche einen Motor für den Supersportwagen Carrera GT brauchte. Kurz davor ist er im Rennwagen LMP 2000 gelandet. Dieser Motor ist deshalb etwas ganz Besonderes unter all dem, was ich für Porsche machen durfte, weil da mein gesamtes Hirnschmalz drinsteckt.
Geht ein Erfinder jemals in Pension? Oder basteln Sie noch heimlich?
Meine letzte erfolgreiche Konstruktion war ein neuer Abfluss-Stöpsel für unsere Edelstahlspüle ...
VITA HERBERT AMPFERER
- Geboren: 6. November 1949 in Hüttau, Österreich
- Ausbildung: Studium Maschinenbau und Kraftfahrzeugbau an der HTL Steyr
Meilensteine und Erfolge:
- Konstrukteur des Aufladesystems des Motors am ersten Serien-Turbo (Porsche 930) Entwicklung von externen Projekten (Seat, GM, Ford, Volvo …) mit „moderner Technologie“ (wassergekühlte Motoren mit vier Ventilen). Aus dieser Zeit stammt eine ganze Reihe von Patenten
- Als Abteilungsleiter Motorkonstruktion Idee zu einem wassergekühlten 911 statt des luftgekühlten Motors
- Wiedergeburt des Porsche-Breitenmotorsports: Vater des GT3 Straßen-und Rennfahrzeugs und der GT2 Straßen-und Rennversion
- Vorentwicklungsprojekt im Motorsport: Projekt GT95 (F1-Motor). Auf dieser Basis Motor für den LMP 2000 und den Carrera GT