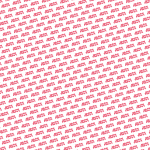EU-Verbrenner-Aus 2035: Skoda-Chef Zellmer zweifelt an E-Auto-Strategie der EU
Gute Fahrt
· 21.10.2025

Hohe Energiekosten gefährden Batterieproduktion in Europa
Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Škoda, hat beim Branchengipfel des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA) in Berlin deutliche Kritik an den Rahmenbedingungen für die Elektromobilität in Europa geübt. Ein zentrales Problem sieht er in den hohen Energiekosten, die eine wirtschaftliche Produktion von Batteriezellen in Deutschland nahezu unmöglich machen. Während in den USA und China die Industriestrompreise bei vier bis fünf Cent pro Kilowattstunde liegen, sind sie in Deutschland "deutlich zweistellig".
Diese Kostendifferenz hat massive Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit: "Nehmen wir als Beispiel einen Unterschied von zehn Cent, dann bedeutet das Mehrkosten von 500 Millionen Euro am Ende des Jahres", erklärte Zellmer. Diese Kostenlücke könne auch durch höhere Effizienz oder Produktivität kaum kompensiert werden. "Das ist wirklich ein Problem, das muss die Politik erkennen", fügte der Manager hinzu.
Die Folgen dieser Kostennachteile werden bereits sichtbar. Mehrere Großprojekte zur Batteriezellfertigung in Europa sind ins Stocken geraten. Unternehmen wie Northvolt, ACC oder Farasis haben ihre Pläne für neue Fabriken zuletzt verschoben oder ganz aufgegeben. Zellmer sieht die Ursache nicht nur in den Strompreisen, sondern auch in regulatorischen Hürden und unklaren Förderstrukturen. "Investitionen fließen dorthin, wo sich Rendite erzielen lässt. Wenn das woanders besser möglich ist, weil die gesetzlichen Bestimmungen oder die Energiepreise dies erleichtern, dann werden wir nach hinten durchgereicht", warnte der Škoda-Chef.
Die Batterieproduktion ist besonders energieintensiv. Studien zeigen, dass bereits heute zwischen 20 und 40 Kilowattstunden Strom benötigt werden, um eine Kilowattstunde Zellkapazität zu produzieren. Bei den aktuellen Strompreisen in Deutschland führt dies zu erheblichen Kostennachteilen gegenüber Produktionsstandorten in Asien oder Nordamerika.
Kein E-Auto für 20.000 Euro – Škoda setzt auf Hybride
Neben den Herausforderungen bei der Batterieproduktion sieht Zellmer auch beim Preisniveau künftiger Elektroautos klare Grenzen. Anders als der Mutterkonzern Volkswagen, der mit dem geplanten ID.1 ein Einstiegsmodell für rund 20.000 Euro anstrebt, wird Škoda diesen Weg nicht mitgehen. Ein Elektro-Škoda in dieser Preisklasse sei aktuell wirtschaftlich nicht umsetzbar.
Der Grund liegt in den Kosten der Batterietechnik: "Weil die Autos und damit auch die Batterien kleiner sind, muss eine bessere Zellchemie eingesetzt werden, um akzeptable Reichweiten zu erzielen. Das wiederum kostet Geld", erläuterte Zellmer. Bei Elektroautos machen die Akkus bis zu 37 Prozent der Herstellungskosten aus, wie aus offiziellen Unterlagen Škodas hervorgeht. Insbesondere in kleineren Fahrzeugklassen sei der Einsatz hochwertiger Zellchemie nötig, um trotz begrenztem Bauraum akzeptable Reichweiten zu erzielen.
Stattdessen verfolgt Škoda eine schrittweise Elektrifizierungsstrategie. Die kleineren Baureihen Fabia, Kamiq und Scala sollen bis mindestens Ende des Jahrzehnts als Mild-Hybrid weiterentwickelt werden. "Wir werden unsere Einstiegsmodelle elektrifizieren, aber nicht rein elektrisch ins Rennen schicken", so der Škoda-Chef (Quelle1). Reine Elektroversionen sind für diese Modelle vorerst nicht geplant.
Die kompakteste und erschwinglichste elektrische Baureihe im Škoda-Portfolio ist derzeit das knapp 4,5 Meter lange Kompakt-SUV Elroq, das ab 33.900 Euro kostet. Im nächsten Jahr folgt das 4,1 Meter lange SUV Epiq zum Preis ab etwa 25.000/26.000 Euro. Für noch kleinere Modelle bleibt die tschechische Automarke vorerst beim Verbrennerantrieb.
Kritik am EU-Verbrenner-Aus und Forderung nach realistischen Zeitplänen
Besonders deutlich äußerte sich Zellmer zum in der EU beschlossenen Verbrenner-Aus ab 2035. Aus seiner Sicht führe das starre Datum in die falsche Richtung. Andere Märkte wie die USA, China oder Indien hätten sich zwar ebenfalls Ziele zur CO₂-Reduktion gesetzt, ließen den Herstellern jedoch mehr Spielraum bei der Umsetzung. Europa sei das einzige Gebiet mit einem verbindlichen Enddatum für den Verbrenner – allerdings mit einer Hintertür für E-Fuels, was in der aktuellen Debatte meist den Tisch falle.
"Wir arbeiten darauf hin, haben aber auch immer gesagt, dass wir flexibel bleiben müssen", so Zellmer zum EU-Ziel. Die gesetzlich definierten CO₂-Ziele müssten regelmäßig überprüft und realistisch an die jeweilige Marktentwicklung angepasst werden. Škoda biete Modelle vom effizienten Verbrenner über hybride Antriebsstränge bis hin zu batteriebetriebenen Fahrzeugen – man stelle sich auf das ein, was der Kunde verlangt.
Um die Transformation realistisch zu gestalten, fordert Zellmer ein europäisches Förderprogramm, das die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen berücksichtigt. Wenn CO2-Grenzwerte für alle Mitgliedsstaaten verbindlich seien, müsse es im Gegenzug auch gemeinsame Maßnahmen zur Unterstützung der Elektromobilität geben. Nur so könne der Markt langfristig wachsen.
"Je eher wir Klarheit und somit Planungssicherheit haben, desto besser. Die ewigen Diskussionen schaffen vor allem Verunsicherung bei den Kunden", betonte der Manager. Der Pfad zu 100 Prozent E-Mobilität müsse dabei "einen realistischen Gradienten haben – und den haben wir in Europa noch nicht". Es gebe nach wie vor Länder in Südeuropa oder im Osten Europas, in denen der Zulassungsanteil elektrischer Fahrzeuge bei zehn Prozent liege.
Insgesamt bleibt Zellmer skeptisch, was die Geschwindigkeit des Wandels betrifft. Vor diesem Hintergrund hält er das Jahr 2035 als Zieldatum für das Verbrenner-Aus für nicht mehr realistisch. Für den Übergang brauche es "sehr wahrscheinlich" stärker als geplant auch Plug-in-Hybride und sogenannte Range Extender.