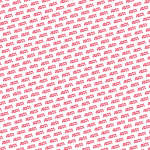Kindersitze 100–150 cm - Sitze für die großen Kleinen

Fast geschafft! Zum letzten Mal steht der Wechsel auf einen größeren Kindersitz an. Der Nachwuchs misst mittlerweile einen Meter, ist um die dreieinhalb Jahre alt und/oder etwa 15 Kilogramm schwer. Das sind die Eckwerte der ehemals sogenannten Kindersitz-Klasse II/III. Sie deckt den Bereich bis zum Ende der in §21 der StVO verankerten Kindersitzpflicht ab. Die entfällt mit dem zwölften Geburtstag des Sprösslings, vorausgesetzt, seine Körperlänge beträgt zu diesem Zeitpunkt mindestens eineinhalb Meter. Andernfalls setzt sich die Verpflichtung zur Nutzung einer entsprechenden Rückhalteeinrichtung solange fort, bis die geforderte Größe erreicht ist. Viele Jahre wurden Kindersitzklassen allein nach dem Gewicht ihrer Passagiere eingeteilt. So war es auch in den Zulassungsnormen verankert, zuletzt in der Vorschrift R44. Allmählich aber setzte sich die Erkenntnis durch, dass für sicheres Autofahren in einem wirklich passenden Sitz weniger das Körpergewicht als vielmehr die Körpergröße entscheidend wirkt. So kam es zur neuen Richtlinie R129, die ab 2014 in drei Stufen eingeführt wurde.






Länge statt Gewicht
Sie teilt die Sitzgelegenheiten ausschließlich nach Körpergröße ein (i-Size). Die früher und auch heute noch oft angegebene Altersgruppe einzelner Klassen dient nur als allgemeiner Hinweis und ist gesetzlich nicht verbrieft. Sitze der Vorgänger-Regelung R44 wurden dadurch übrigens nicht verboten und dürfen auch jetzt noch weiter genutzt werden. Konkret betrifft das Sitze nach R44/03 und R44/04. Seit soeben, seit dem 1. September, ist jedoch der Verkauf neu auf den Markt kommender Kindersitze mit dieser Norm nicht mehr erlaubt (Ausnahme: Abverkauf von Lagerware bis August 2024). Daher wurden – mit einer Ausnahme – auch alle Sitze dieses Praxistests nach UN ECE Reg. 129/03, wie sie in korrektem Amtsdeutsch heißt, abgenommen. Lediglich der Recaro, der schon geraume Zeit auf dem Markt ist, trägt noch das 129/02-Label. Die Prüfvoraussetzungen entsprechen dabei vollumfänglich denen der /03-Version, die lediglich eine Erweiterung des Kreises möglicher Prüflinge enthält, weshalb nun auch ein Sitz ohne Isofix-Anbindung, wie der Graco aus diesem Test, nach R129/03 abgenommen werden kann. R129 sieht insbesondere umfangreichere Crashtest-Prozeduren vor. So muss nun auch ein Sicherheitsstandard für einen Seitenaufprall nachgewiesen werden.
Sicherung mit dem Gurt des Pkw
Wesentliches Merkmal der Klasse 100–150 Zentimeter ist die Sicherung des Kindes direkt mit dem Sicherheitsgurt des Autos. Genau genommen handelt es sich nicht einmal mehr um Kindersitze, sondern um sogenannte Sitzerhöhungen. Die gibt es als einfache Sitzerhöhung in Form einer kleinen Sitzfläche, als solche mit Gurtführung nur für den Beckengurt und als Sitzerhöhung mit Rückenlehne. Letztere ist aus Sicherheitsgründen unbedingt vorzuziehen. Durch ihre seit lichen Flanken und ihre Kopfstütze bietet sie deutlich mehr Schutz bei einem Seitenaufprall. Die Rückenlehne sorgt für den richtigen Verlauf des Schultergurts. Die ausgeprägten Führungshörner verhindern das Hochrutschen des Beckengurts beim Aufprall. Nicht zuletzt stabilisiert die Kopfstütze den Kopf des schlafenden Kindes.




Die Sitzerhöhung mit Gurtführung hält zwar den Beckengurt an seiner Stelle, bietet darüber hinaus jedoch keinerlei weiteren Schutz. Das gilt erst recht für die einfache Sitzerhöhung, weshalb von deren Verwendung dringend abzuraten ist. Die gesetzlichen Vorgaben freilich erfüllen auch die beiden Letztgenannten, weshalb sie ab einer Körpergröße von 125 Zentimeter und mehr als 22 Kilogramm Körpergewicht zugelassen sind. Wie bei den vorausgegangenen Kindersitzgrößen empfiehlt sich auch bei der Endstufe vor Kauf eine Einbauprobe im eigenen Fahrzeug, insbesondere, wenn im Auto über den Rücksitzen nicht allzu viel Platz vorhanden ist. Und freilich schadet es auch nicht, das Kind probesitzen zu lassen. So war unser Model Felicia vom BeSafe überhaupt nicht begeistert wegen seiner Beckengurtschlaufe, die objektiv ja eindeutig ein positives Sicherheitsmerkmal zur Gurtführung beiträgt.




Zulassung beachten
I-Size-Sitze dürfen an allen entsprechend mit einer Textilfahne gekennzeichneten Sitzplätzen im Auto montiert werden. Verfügt ein Sitzplatz nicht über diese kleine Logofahne, muss in der Fahrzeugliste des Kindersitzherstellers nach dem Autotyp gesucht werden. Findet sich der eigene Wagen dort nicht, darf dieser Sitz nicht als Platz für den Nachwuchs genutzt werden. Für die Nutzung des Beifahrersitzes – vorausgesetzt, er ist als i-Size-Sitz gekennzeichnet oder in der Fahrzeugliste als zulässig ausgewiesen – bedeutet das, dass der Airbag – im Gegensatz zu rückwärts gerichteten Vorgängersitzen – nicht mehr abgeschaltet werden darf. Allerdings empfiehlt es sich, den Autositz so weit wie möglich nach hinten zu schieben.
Noch ein aktueller Hinweis: In den Bedienungsanleitungen der Kindersitze, aber auch in denen einiger Autohersteller, steht in der Regel geschrieben, dass eine Kopfstütze des Fahrzeugsitzes ausgebaut werden soll, wenn sie den Kindersitz daran hindert, mit seiner Rückenlehne schlüssig an die Sitzlehne herangeschoben zu werden. Der ADAC konnte in Crashversuchen nachweisen, dass die abstützende Wirkung der Kopfstütze des Autos beim Heckaufprall die auftretenden Kräfte im oberen Nackenbereich deutlich reduziert, ohne erkennbare Nachteile oder Gefährdungen wie beispielsweise einem Durchbrechen der Lehne des Kindersitzes aufgrund des Hohlraums zwischen Kindersitz und Fahrzeuglehne. Der Ausbau einer Autositz-Kopfstütze sollte also gewissenhaft abgewägt werden. Acht der elf Sitze dieses Praxistests wurden vom ADAC oder der Stiftung Warentest einer umfangreichen Sicherheitsprüfung unterzogen.




Viel dazugelernt: Alle waren gut
Alle haben mit „Gut“ abgeschnitten. Nicht im Test waren bislang Avova, Lionelo und der ganz neue Osann. Da der Schutz bei einem Seitenaufprall nun im Fokus steht, findet man viele Varianten der zur Türseite hin aufsteckbaren Prallschutzkörper. Teils müssen sie zwingend montiert sein (Avionaut, Graco, Nuna oder Swandoo), teils können sie den Platzverhältnissen entsprechend eingesetzt werden (BeSafe, Joie, Recaro). Einige Hersteller verzichten darauf und haben die Seitenlehnen ihrer Produkte entsprechend stoßabsorbierend konstruiert, wie Avova, Lionelo, Maxi-Cosi oder Osann.
Bis auf den Graco verbinden sich alle Sitze in diesem Test per Isofix-Konnektoren mit den entsprechenden zwei Haltebügeln der Fahrzeugsitze. Bei den meisten sind die beiden Rastarme miteinander verbunden und sie sind dann in der Regel auch schwenkbar ausgeführt, was das Einführen erleichtert. Sitze, die noch über einzeln ausziehbare Rastarme verfügen, haben meist starre Arme, was das Einführen je nach Autositz erschwert. Bei Fahrzeugen, deren Isofix-Bügel tief im Sitz versteckt untergebracht sind, helfen Isofix-Einführhilfen, die bei einigen Kandidaten zur Grundausstattung zählen. Das Einchecken in die Isofix-Halter sollte an jeder Seite separat vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass die Verbindung fix zustande gekommen ist. Angezeigt wird das durch den grün eingefärbten Indikator. Die Sitzgelegenheit nach dem Andocken jetzt noch kräftig Richtung Autositzlehne schieben, sodass sie im Idealfall schlüssig an der Lehne anliegt.



Kontrolle der Isofix-Rastung
Sobald der junge Fahrgast seinen Hocker bestiegen hat, muss der noch zu ihm passend eingestellt werden, insbesondere in Bezug auf die korrekte Position der Kopfstütze. Im Regelfall sollte dabei deren Unterkante knapp über der Schulter stehen, weil so die sicherste Führung des Schultergurts gewährleistet ist. Nun eventuell noch Beinauflagenverlängerung (Recaro, Joie, Nuna) oder Ruhestellung (Avionaut, BeSafe, Lionelo, Maxi-Cosi, Recaro) einstellen. Dann erst den Gurt zunächst oben in die Führung an der Kopfstütze einfädeln. Das gelingt besonders leicht bei allen Sitzen, deren Gurtführung über einen federgespannten Sicherungshaken verfügt. Tatsächlich geht das aber beim Avionaut und beim Osann mit starrem Widerhaken auch ganz gut, beim Recaro und beim Lionelo muss man fummeln. Das muss man beim Ausfädeln an allen vieren. Es hilft aber zumeist, die Kopfstütze ein Stück hoch zu ziehen.
Die Höherstellung der Kopfstützen funktioniert in der Regel über einen Zuggriff an der Stütze. Der Swandoo nutzt dazu eine Zugschlaufe, der BeSafe verfügt beidseitig über einen Drehgriff – speziell bei engen Platzverhältnissen praktisch, weil man von der Seite ganz einfach auf den Knopf Zugriff hat, während einem die Zuggriffe beim Hochziehen der Kopfstütze eine Verrenkung abnötigen. Ein weiterer Nachteil der verbreiteten Zuggriffe wird deutlich, wenn man den Sitz zum Auto oder sonst wohin tragen will und dabei intuitiv in den Griff fasst. Dann rattert der restliche Sitz unweigerlich nach unten. Der BeSafe kann das besser: Bei ihm sitzt dort oben tatsächlich ein ausziehbarer Tragegriff.




Keiner fällt durch
Erwähnenswert wäre noch, dass einige Hersteller über die gesetzliche Gewährleistungsfrist hinaus Garantie anbieten: Beim Avionaut sind das zehn Jahre, vorausgesetzt, man registriert den Erwerb innerhalb von 28 Tagen, beim Swandoo gibt es gar eine lebenslange Garantie bei Registrierung innerhalb von drei Monaten. Ein QR-Code in der Bedienungsanleitung führt jeweils direkt zum Registrierungsportal. Und auch das Thema Entsorgung sei noch erwähnt: Recaro stellt dazu eine detaillierte Anleitung bereit, andere legen zumindest eine maximale Nutzungsdauer fest: BeSafe acht Jahre, Avionaut zehn und Avova, der einzige Sitz Made in Germany im Test, zwölf Jahre.
Die Preisspanne reicht von 95 bis 350 Euro, das Gewicht bewegt sich zwischen 4,24 und 8,65 Kilogramm. Die Sitzbreite geht von 41 bis 56, die Sitzhöhe von 79 bis 85 Zentimeter. Gut sind sie alle
Fazit: Alle Testkandidaten schneiden gut ab, der eine hat hier einen kleinen Vorteil, der andere dort. Es kristallisiert sich weder ein Überflieger noch ein Ausreißer ins Negative heraus. Entscheidungskriterium kann also tatsächlich die Optik, ein spezielles Detail oder eben der Preis sein. Da macht man zum Schluss nichts verkehrt. Und dann hat sich das Thema Kindersitz auch endlich erledigt.