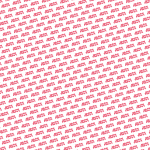Blitzermarathon bringt verstärkte Tempokontrollen europaweit
Gute Fahrt
· 05.08.2025

Europaweite Aktion für mehr Verkehrssicherheit
Die "Speedweek" ist zurück auf Europas Straßen. Vom 4. bis 10. August führt die Polizei in mehreren deutschen Bundesländern und europaweit verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Aktion, die auch als Blitzermarathon bekannt ist, findet zweimal jährlich statt – im April und im August, wobei die Frühjahrskontrollen in der Regel umfangreicher ausfallen (Quelle1). Hinter der Initiative steht das European Roads Policing Network (Roadpol), ein Zusammenschluss europäischer Verkehrspolizeien, die sich gemeinsam für mehr Sicherheit auf den Straßen einsetzen.
In Deutschland beteiligen sich dieses Mal acht Bundesländer an der Aktion: Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Hessen. Anders als beim Blitzermarathon im Frühjahr werden die genauen Kontrollstellen diesmal nicht vorab bekannt gegeben. Lediglich in Frankfurt wurden einige Schwerpunkte kommuniziert, darunter Lkw-Kontrollen auf der A5 sowie verstärkte Überwachung auf der Mainzer Landstraße und der Hanauer Landstraße – beides Strecken, die als besonders unfallträchtig gelten (Quelle3).
Die Polizei setzt bei den Kontrollen auf verschiedene Methoden. In Baden-Württemberg kommen anderem Laserhandmessgeräte, Videofahrzeuge, Blitzer-Anhänger und stationäre Blitzanlagen zum Einsatz. In Südhessen liegt der Fokus verstärkt auf zivilen Einsatzkräften, die besonders aggressive Raser im Blick behalten sollen – auch auf Landstraßen oder in der Nähe von Gefahrenstellen wie Schulen oder Altenheimen.
Besonders intensiv kontrolliert wird laut ADAC "auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage". Dazu zählen Schulen, Altenheime, Kliniken, aber auch Bushaltestellen, Fußgängerüberwege und Baustellen (Quelle2). Die Behörden betonen, dass es nicht primär darum gehe, möglichst viele Verstöße zu erfassen, sondern vielmehr das "Augenmerk auf die eigene Geschwindigkeit und deren Bedeutung für die Verkehrssicherheit" zu lenken.
Überhöhte Geschwindigkeit als Hauptunfallursache
Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Unfallursache Nummer eins für tödliche Verkehrsunfälle auf deutschen Straßen. Laut Statistischem Bundesamt traf dies im vergangenen Jahr auf 30 Prozent der Unfälle mit Todesfolge zu. Danach folgen zu geringer Abstand und Missachtung der Vorfahrt (Quelle2).
Besonders gefährdet sind dabei vulnerable Verkehrsteilnehmer wie Kinder und ältere Menschen. Von den zehn Kindern, die 2024 im Straßenverkehr getötet wurden, waren vier zu Fuß unterwegs. Bei den über 65-Jährigen ist die Situation noch dramatischer: Von 184 im Verkehr getöteten Senioren waren 48 als Fußgänger unterwegs (Quelle4). Viele dieser Unfälle ereignen sich an Stellen, wo wichtige Infrastruktur wie Bankfilialen oder Supermärkte vorhanden sind, aber kein direkter Überweg existiert.
"Der nächste Zebrastreifen ist 400 Meter rechts davon, die nächste Ampel 400 Meter links", beschreibt Roland Stimpel vom Fußgängerverband FUSS e.V. die Situation. Weil das für viele ältere Menschen viel zu lange Umwege bedeute, versuchten sie es dann auf eigene Faust über die Straße – manchmal mit schlimmen Folgen. Bei der Verkehrsplanung sollten "nicht die Menschen dem schnellen Fahrverhalten angepasst werden, sondern umgekehrt", fordert Stimpel (Quelle4).
Das NRW-Verkehrsministerium betont ebenfalls die gesellschaftliche Verantwortung bei der Fußgängerplanung: "Wenn der Fußweg sicher, gut gestaltet und auch mit Bänken zum Rasten versehen ist, fördert er die Eigenständigkeit von Menschen vor Ort." Wer sich auch im hohen Alter "möglichst sicher und eigenständig in seinem Umfeld bewegen und damit selbst versorgen kann, kann länger selbstbestimmt auch in der eigenen Wohnung leben."
Bußgelder und Konsequenzen bei Tempoüberschreitungen
Wer während der "Speedweek" mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt wird, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Die Bußgelder wurden zu Beginn des Jahres angepasst und sind dadurch teurer geworden. Die Höhe richtet sich nach dem Ausmaß der Überschreitung und dem Ort des Verstoßes – innerorts fallen die Sanktionen in der Regel höher aus als außerorts.
Wer mit einem Auto innerorts bis zu 10 km/h zu schnell fährt, muss mit einem Bußgeld von 30 Euro rechnen. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung zwischen 21 und 25 km/h werden bereits 115 Euro fällig, zudem gibt es einen Punkt in Flensburg. Bei höheren Überschreitungen drohen zusätzlich Fahrverbote. Das höchste Bußgeld wird innerorts bei mehr als 70 km/h zu viel verhängt: 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot (Quelle2).
Außerorts sind die Geldbußen ähnlich gestaffelt. Sie reichen von 20 Euro (bis 10 km/h zu schnell) bis hin zu 700 Euro, zwei Punkten und drei Monaten Fahrverbot (mehr als 70 km/h zu schnell). Zu beachten ist auch, dass Apps, die automatisiert vor Blitzern warnen, in Deutschland verboten sind. Bei Verstoß drohen eine Geldbuße in Höhe von 75 Euro und ein Punkt in Flensburg.
Im europäischen Vergleich fallen die deutschen Bußgelder allerdings moderat aus. In Österreich beispielsweise können Geschwindigkeitsübertretungen von 40 bis 60 km/h innerorts beziehungsweise 50 bis 70 km/h außerorts mit 300 bis 5.000 Euro geahndet werden. Die Gewerkschaft der Polizei fordert daher höhere Geldbußen als weiteres Mittel gegen zu schnelle Fahrerinnen und Fahrer. Manche drückten "auf die Tube, weil hierzulande noch immer in einem Bußgeld-Discountland" gefahren werde, so der Vize-Bundesvorsitzende Michael Mertens (Quelle2).
Erste Ergebnisse der aktuellen "Speedweek" liegen bereits vor. Der Odenwaldkreis zog schon am ersten Tag ein Zwischenfazit: Innerhalb von vier Stunden wurden bei 382 kontrollierten Fahrzeugen insgesamt 61 Verkehrssünder gezählt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Verkehrsteilnehmer aus dem Odenwaldkreis, der mit 99 Stundenkilometern in einer 50er-Zone unterwegs war (Quelle3). Eine umfassendere Bilanz wird zum Ende der Woche erwartet.
Im Überblick
- Zeitraum: 4. bis 10. August
- Teilnehmende Bundesländer: Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Hessen
- Organisation: European Roads Policing Network (Roadpol)
- Kontrollschwerpunkte: Unfallträchtige Streckenabschnitte, Schulen, Altenheime, Kliniken, Bushaltestellen, Fußgängerüberwege, Baustellen
- Kontrollmethoden: Laserhandmessgeräte, Videofahrzeuge, Blitzer-Anhänger, stationäre Blitzanlagen
- Bußgeld (innerorts 21-25 km/h zu schnell): 115 Euro plus 1 Punkt
- Bußgeld (innerorts >70 km/h zu schnell): 800 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot