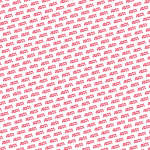Der Winkelhock-Porsche: Vaters ganzer Stolz




„Wenn ich aussteige“, sagt Markus Winkelhock mit Blick auf den Porsche, den sein Vater einst fuhr, „freue ich mich schon aufs nächste Einsteigen“
Hat er nicht kurz innegehalten, bevor er den Wagen auf schloss? Nicht gezögert oder gewartet, innegehalten, einen Moment nur. Einen Augenblick, in dem er in sich ging, sich sammelte. So ein Augenblick, bevor man Dinge tut, die man nicht einfach so tut.
Zu verstehen wäre das. Denn dies ist nicht irgendein Auto, in das er sich setzt, nicht irgendeines der vielen, die er sonst bewegt, weil es nun mal sein Beruf ist, Rennfahrer, so sehr wie vielleicht auch eine innere Notwendigkeit. Dies ist das Auto, das ihn bewegt. Nicht weil es ein Porsche ist, nicht weil es ein Elfer ist, nicht weil er ihm gehört. Sondern weil es dieser Porsche 911 ist. „Mein Vater“, sagt Markus Winkelhock, öffnet die Tür des weißen G-Modells und findet wie von selbst seinen Platz auf dem Fahrersitz, „hat dieses Auto geliebt. Als er mal abends spät vom Rennen am Nürburgring zurückkam, hat meine Mutter erzählt, hörte sie ihn auf den Hof rollen und dachte, gleich würde die Tür aufgehen. Aber das dauert zehn Minuten, 15, 20. Und da guckt sie nach draußen und sieht, wie er da das Auto wäscht.“
Das ist so eine der Geschichten, die Markus Winkelhock erzählen kann. Nicht weniger amüsiert als in Gedanken, weil sie auch ihm erzählt und so zu einer Erinnerung wurde, die er selbst nicht hatte an seinen Vater Manfred. Manfred Winkelhock, einer der besten deutschen Rennfahrer, kaufte das G-Modell nur sechs Wochen bevor er im August 1985 bei einem Langstreckenrennen in Kanada verunglückte. Da war Markus fünf Jahre alt. Später wird Markus, GT- und Sportwagenpilot und lange in der DTM unterwegs, in Interviews sagen, er habe seinen Vater nie richtig kennengelernt. Sehe er Fernsehbilder von ihm, wirke er manchmal wie eine fremde Person, und er könne sich nicht wirklich erinnern. Obwohl er – alte Bilder zeigen das in Schwarz-Weiß – mit dem Dreirad um den Vater herumfuhr, während der vor dem Haus an seinen Kleinstwagen schraubte, die er so mochte. Kleinschnittger, Isetta, Messerschmitt. Und Markus, wenn er eine Runde gedreht hatte, neben dem Vater verharrte, die Augen ganz auf ihm und dem, was der da tat.

Er fasst das Auto an, als fasse es ihn nicht weniger an
Ein paarmal nur dreht der Anlasser, dann startet der Boxer und kommt, vom typisch ruhigen Singen begleitet, schnell in einen gleichmäßigen Leerlauf. „Er springt eigentlich immer gleich an, auch wenn er länger gestanden hat. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich von Prag, wo ich jetzt wohne, nach Hause komme und mit dem Auto fahren kann.“ Aus der Doppelgarage, die der Porsche sich teilt mit einem Kompakten, einem Laubbläser, Besen, zwei Mülltonnen und einem Metallregal voller Gartenutensilien – Blumentöpfe, Pflanzendünger –, lenkt Markus den Wagen langsam, ganz langsam heraus, schräg, damit auf der steilen gepflasterten Einfahrt die Front nicht aufsetzt. Schon auf diesen ersten zwei, drei, vier Metern aber ist zu merken, wie er dieses Auto anfasst: so, als fasse es ihn nicht weniger an.
Als es kurz darauf aus dem Ort heraus eine sich windende Landstraße entlanggeht, 50, 60, 70, da schon der Vierte, ist es, als erspüre er bei jedem Schaltvorgang, wie das Getriebe ihm erlaubt, den nächsten Gang einzulegen. So, als folge seine Hand nicht weniger dem Schalthebel, als der Schalthebel seiner Hand folgt, die ihn sachte durch die Gasse führt. „Da sind ja, ich weiß nicht genau, wie viele Liter Öl im Motor. Und ich stelle mir immer vor, wie das ganze kalte und zähe Öl allmählich erst auf Temperatur kommt und an all die Stellen kriecht, an die es hinmuss.“
»Ich versuche, so mit dem Auto umzugehen, WIE ER ES GETAN HÄTTE«
Der Porsche war wie ein Heiligtum für Manfred Winkelhock
Er lässt das Fenster runter, links Streuobstwiesen, rechts ein Waldstück, am wolkenlosen Himmel schwebt ein Kleinflugzeug. Nachdem in der letzten Woche der Wind schon die ersten Blätter von den Bäumen gerissen hatte, ist es noch mal warm geworden und spätsommersonnig, ein Tag also, an dem der Porsche auf die Straße darf. „Im Regen“, sagt Markus, „würde ich ihn nicht bewegen wollen.“ Das Blech würde wohl wieder trocken wie jedes andere auch. Doch ist dieser Porsche eben nicht wie jedes andere Blech. „Ich fühle mich eins mit diesem Auto und so behandele ich es auch.
Du spürst ja, was ihm guttut und was nicht.“ Er spricht, durch eine lange Linkskurve eilend, als gehe es um eine Person, und vielleicht ist das ein Stück weit ja auch so.
Was gibt es von jenen, die gestorben sind und an die wir kaum eine Erinnerung haben? Was bleibt, was erschaffen wir vielleicht neu? Wo begegnen wir ihnen, wie sehen wir sie, wie sehen wir uns selbst mit ihnen und ohne sie? In welchen Geschichten bleiben sie lebendig, in welchen Gegenständen werden sie greifbar? Bleiben die Fragen, die wir stellen wollen und die uns überkommen, dieselben? Oder verändern sie sich wie die Bilder, die wir im Kopf behalten, Bilder, die wir sahen, und solche, die wir uns nur vorstellen? Und was hilft uns, mit einer Abwesenheit klarzukommen, die am Ende doch keiner wirklich versteht?
„Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass ich mich, wenn ich mit dem Auto fahre, irgendwie jemandem näher fühle. Es ist einfach schön zu wissen, dass es sein Auto war, das Auto von meinem Vater. Und natürlich ist es etwas ganz anderes für mich, mit diesem Carrera zu fahren als mit irgendeinem anderen. Auch das würde Spaß machen, aber die Verbindung ist hier schon eine ganz andere Sache. Da ist das Bewusstsein, dass eine besondere Verantwortung daran hängt, weil es ein Erbstück ist. Der Porsche war wie ein Heiligtum für meinen Vater. Er war brutal stolz darauf. Und ich kann nur versuchen, so mit dem Auto umzugehen, wie er wohl auch damit umgegangen wäre.“






Markus wäscht den Carrera von Hand und trocknet ihn von Hand, bläst mit einem Kompressor das Wasser aus den Türholmen, um ihn nach jeder Wäsche auch ein paar Kilometer trocken zu fahren. Kürzlich erst war der Porsche bei einem Freund der Familie, Alois Ruf, damit man sich in dessen Werkstatt um alles würde kümmern können, was nötig, und auch um das, was nicht unbedingt nötig wäre. Um alles also, was dieser Porsche nach etwa 55.000 Kilometern brauchte, und das, was er verdiente. „Ein großer Service mit ein paar Extras“, sagt Markus. Die Benzinpumpe hatte Geräusche gemacht, die Ölschläuche wurden langsam porös, die Kupplung ist neu, die vordere Stoßstange frisch lackiert, im Motorraum war der alte Schaum vor sich hin zerbröselt. „Manches“, sagt Markus, „waren nur Kleinigkeiten. Der Fernlichthebel hatte einen Wackelkontakt, die Öldruckanzeige bekam einen neuen Geber, der Schlüssel“, er drückt drauf und es leuchtet, „eine neue Batterie. Was ist das schon nach all den Jahren. Stell dir vor, der ist ja fast so alt wie ich.“
Martina Winkelhock gibt den Porsche zunächst einem Freund
Weiß er noch, wann er anfing, damit zu fahren? Wie hat es sich angefühlt? Markus ist auf einen Wanderparkplatz gerollt, jetzt lehnt er da am Kotflügel mit Blick über die Höhen des Schwäbischen Walds und grübelt. „Genau weiß ich das gar nicht. Das muss so in meinen frühen Zwanzigern gewesen sein. Bis dahin hatte ihn meine Mutter ab und zu bewegt. Aber von dem Moment an, als ich begann, damit zu fahren, fuhr sie ihn nicht mehr.“
Sie habe es, räumt Martina Winkelhock ein, in dem Sommer damals kaum ertragen können, den Porsche dort in der Garage stehen zu sehen, weil so viel mit ihm verbunden war. Sie gibt den Porsche an einen Freund, merkt aber bald schon: Das war ein Fehler. Sie ruft den Freund an und der sagt ihr: „Das war mir klar.“ Der Freund hatte den Wagen abgemeldet, nicht aber auf sich zugelassen. Er wusste, worum es ging. „Immer schon“, sagt Martina Winkelhock, „war das Manfreds Traum gewesen, ein weißer Carrera, und als er schließlich eines Abends damit heimkam, freute er sich wie ein kleines Kind. ,Komm‘, hat er gesagt, ,wir machen gleich eine Runde.‘ Du“, sagt sie zu Markus, „hattest, glaube ich, schon den Schlafanzug an. Das war das erste Mal, dass wir gemeinsam in dem Porsche fuhren, und du, hinten auf dem Rücksitz, fandest es so toll.“
Die Begeisterung ist in nun fast 40 Jahren eine andere geworden. Aber sie ist immer noch da. „Und ich genieße es“, sagt Martina Winkelhock, während ihr Sohn den Porsche langsam, ganz langsam zurücklenkt in die Garage, kurz noch die Hände auf dem Lenkrad liegen lässt, bevor er aussteigt und die Tür schließt, „dass der Markus das Auto so schätzt.“