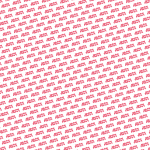Im Vergleich: VW ID.3 gegen Golf eTSI
Gute Fahrt
· 14.11.2025






Kostenvergleich zeigt klaren Sieger
Der Kostenvergleich über vier Jahre und 60.000 Kilometer fällt eindeutig aus: Der Golf 1.5 eTSI kostet 0,51 Euro pro Kilometer, der ID.3 Pro liegt bei 0,53 Euro. Obwohl der Preisunterschied beim Kauf nur rund 500 Euro beträgt, entwickeln sich die Gesamtkosten unterschiedlich. Der ID.3 startet mit einem Grundpreis von 36.425 Euro, der Golf kostet 35.930 Euro.
Bei den laufenden Kosten zeigt sich ein differenziertes Bild: Kraftstoff- und Stromkosten fallen mit 6.542,40 Euro für den Golf deutlich höher aus als die 4.567,20 Euro für den ID.3. Hinzu kommen beim Benziner 288 Euro Steuern über vier Jahre, während der Elektro-VW steuerbefreit bleibt. Auch bei der Wartung liegt der ID.3 mit 800 Euro günstiger als der Golf mit 1.500 Euro.
Den entscheidenden Unterschied macht jedoch der Wertverlust: Der Golf verliert über vier Jahre 18.011,71 Euro, der ID.3 dagegen 21.097,36 Euro. Diese Differenz von über 3.000 Euro lässt sich auch über günstige heimische Stromtarife nicht kompensieren. Zusätzlich wirkt sich die ungünstigere Versicherungseinstufung des ID.3 aus: 5.574,36 Euro stehen 4.162,40 Euro für den Golf gegenüber.
Fahrdynamik und Antriebscharakter
Beide Volkswagen zeigen unterschiedliche Charaktere beim Fahren. Der ID.3 Pro überzeugt mit seinem Hinterradantrieb, der für sichere Traktion bei gleichzeitig unbehelligtem Lenkgefühl sorgt. Das Elektroauto lenkt sich sehr leichtgängig und kommt im Fahrbetrieb ausgesprochen harmonisch rüber. Die 150 kW (204 PS) und 310 Nm maximales Drehmoment sorgen für spontane Beschleunigung: 7,6 Sekunden von null auf 100 km/h.
Der Golf 1.5 eTSI benötigt mit 8,4 Sekunden etwas länger für den Standardsprint, bietet dafür aber deutlich mehr Reserven bei hohen Geschwindigkeiten. Während der ID.3 bei 160 km/h elektronisch abgeregelt wird, rennt der Golf mit Rückenwind an die 230 km/h schnell. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 224 km/h. Diese Autobahn-tauglicheren Reserven machen sich besonders bei längeren Strecken bemerkbar.
Der Mildhybrid-Vierzylinder mit Turboaufladung entwickelt 110 kW (150 PS) und 250 Nm Drehmoment. Er lässt sich untertourig fahren, ohne dass er murrt, mag auch drehen und beherrscht die ausgewogene Mitte. Allerdings knurrt der 1.5er Last und Drehzahl ein typisch raues Vierzylinder-Lied. Störend laut wird der Turbobenziner jedoch nie.
Komfort und Fahrverhalten im Detail
Beim Federungskomfort zeigen beide VW-Modelle identische Qualitäten. Der ID.3 rollt jedoch sanfter ab und profitiert von den Akkupaketen im Wagenboden, die wie eine dicke Isolierung funktionieren. Dadurch dringen deutlich weniger Fahrwerks- und Reifengeräusche in den Innenraum. Der Golf kann bei mäßiger Fahrt ebenfalls leise sein, zeigt aber die typischen Verbrennungsmotor-Geräusche.
Ein wichtiger Unterschied zeigt sich bei der Sitzposition: Im Golf fühlt man sich dank tiefer Sitzposition feinfühliger ins Auto integriert und von den Sitzen stärker gestützt. Im ID.3 sitzt man immer etwas obenauf, gelöster. Auf schlechten Straßenoberflächen kommen beim Elektroauto deutlich mehr Aufbaubewegungen dazu, was ein unruhigeres Fahrgefühl zur Folge hat.
Die Raumaufteilung fällt bei beiden Modellen praktisch aus: Der ID.3 bietet mit 385 bis 1.267 Liter einen minimal größeren Kofferraum als der Golf mit 381 bis 1.237 Liter. Bei der Zuladung liegt der Golf mit 500 Kilogramm vor dem ID.3 mit 448 Kilogramm. Das höhere Leergewicht des Elektroautos von 1.832 Kilogramm gegenüber 1.360 Kilogramm beim Golf resultiert hauptsächlich aus der Batterie.
Bedienung und Alltagstauglichkeit
Beide Fahrzeuge setzen auf moderne Bedienkonzepte mit großen Zentralbildschirmen, die jedoch Einarbeitungszeit erfordern. Der ID.3 wirkt mit seinem großen Head-up-Display und dem kleinen aufgesetzten Extra-Display für den Fahrer moderner gestaltet. Besser ablesbar sind jedoch die einstellbaren digital-analogen Uhren des Golf.
Ein wichtiger Unterschied zeigt sich bei der Lenkradbedienung: Der Golf verwendet echte Tasten in den Lenkradspeichen, während der ID.3 auf haptisch unausgegorene Slider setzt. Für beide Modelle gilt: Die Steuerung der Funktionen über den großen Zentralbildschirm lenkt deutlich ab und erfordert Gewöhnung.
Bei der Reichweite zeigt sich der größte Unterschied zwischen beiden Antriebskonzepten: Der Golf schafft im Test 862 Kilometer pro Tankfüllung, der ID.3 erreicht 364 Kilometer. Selbst die WLTP-Reichweite des Elektroautos von 434 Kilometern liegt deutlich der Praxis-Reichweite des Benziners. Für Langstreckenfahrer bleibt dies ein wichtiges Argument für den konventionellen Antrieb.
Der Golf bereitet auf Landstraßen schlicht mehr Laune beim Fahren. Er wirkt insgesamt angenehm satt, präzise, mechanisch und authentisch. Hier kann auch das beste Elektromodell nicht vollständig mithalten, obwohl der ID.3 mit seinem harmonischen Fahrverhalten und der sanften Abrollung durchaus überzeugt.
Stärken und Schwächen
- ID.3 bietet harmonisches Fahrgefühl mit Hinterradantrieb
- Golf überzeugt mit 862 Kilometer Reichweite
- Elektromotor setzt sich müheloser aus dem Stand in Bewegung
- Golf wirkt satt, präzise und authentisch auf Landstraßen
- ID.3 rollt sanfter ab mit weniger Fahrwerks- und Reifengeräuschen
- ID.3 hat 3.000 Euro höheren Wertverlust über vier Jahre
- Drosselung des ID.3 auf 160 km/h wirkt wie Hemmschuh
- Golf knurrt Last mit rauem Vierzylinder-Lied
- ID.3 zeigt mehr Aufbaubewegungen auf schlechten Straßen
- Bedienkonzepte beider Fahrzeuge lenken deutlich ab