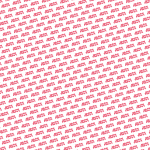Bidirektionales Laden macht E-Autos für jeden zu sparsamen Energiespeichern

Rollende Kraftwerke für die Energiewende
Bidirektionales Laden gilt als Schlüsseltechnologie für die Energiewende und könnte E-Autos zu dezentralen Energiespeichern machen. Das Prinzip ist einfach: Elektroautos beziehen nicht nur Strom aus dem Netz, sondern speisen ungenutzte Energie auch wieder zurück. Diese Technologie, auch bekannt als Vehicle-to-Grid (V2G), ermöglicht es, Elektrofahrzeuge als mobile Energiespeicher zu nutzen (Quelle4). Besonders in Zeiten, in denen erneuerbare Energien wie Wind- und Solarkraft mehr Strom produzieren als benötigt wird, könnte dieser in den Fahrzeugbatterien zwischengespeichert werden, anstatt ungenutzt zu verpuffen.
Die Idee dahinter ist so simpel wie effektiv: Strom, der in Zeiten der Überproduktion ungenutzt verloren gehen würde, wird im Fahrzeugakku zwischengespeichert und später, wenn der Bedarf im Stromnetz besonders groß ist, wieder abgerufen. Für diese "Speichermiete" erhalten E-Auto-Besitzer eine finanzielle Kompensation (Quelle5). Angesichts der politischen Zielsetzung von zehn Millionen Elektrofahrzeugen in Deutschland bis 2030 könnten diese gemeinsam einen gewaltigen Energiespeicher bilden, der das Stromnetz stabilisiert und flexibler macht.
Lange Zeit galt jedoch die Sorge, dass das häufige Be- und Entladen den Fahrzeugbatterien schaden und ihre Lebensdauer erheblich verkürzen könnte. Diese Bedenken scheinen nun ausgeräumt zu sein. Eine aktuelle Studie der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen in Zusammenarbeit mit dem Ladeanbieter The Mobility House Energy hat untersucht, wie stark bidirektionales Laden die Batteriealterung tatsächlich beeinflusst. Die Ergebnisse sind überraschend positiv: Die zusätzliche Alterung der E-Auto-Batterien durch bidirektionales Laden beträgt in zehn Jahren gerade einmal 1,7 bis 5,8 Prozent (Quelle4).
Für die Studie wurden drei verschiedene Batteriepakete mit einer Kapazität von jeweils 53 kWh und einer Spannung von 335 Volt verwendet. Diese Werte entsprechen in etwa den Leistungsdaten eines Elektroautos mit mittelgroßem Energiespeicher. Um verschiedene Batterietechnologien abzudecken, enthielt eines der Pakete Rundzellen, eines Pouchzellen und eines prismatische Zellen – die drei gängigsten Zelltypen in modernen Elektrofahrzeugen.
Intelligentes Lademanagement schont die Batterie
In der Untersuchung wurden drei verschiedene Lade-Szenarien durchgespielt: gewöhnliches Laden, intelligentes Laden ("smart charging") und bidirektionales Laden. Die Forscher führten so viele Ladezyklen durch, wie es einem Zehn-Jahres-Betrieb entsprechen würde (Quelle5). Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Lademethoden.
Erwartungsgemäß erwies sich das direkte, unverzügliche Laden als am schädlichsten für die Batterielebensdauer. Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass der Akku häufig auf 100 Prozent aufgeladen wird und dann lange Zeit in diesem vollgeladenen Zustand verbleibt, ohne dass die gespeicherte Energie schnell wieder abgerufen wird. Dieses lange Verweilen im voll geladenen Zustand beschleunigt die Alterungsprozesse in der Batterie. Beim intelligenten Laden werden solche hohen Ladestände dagegen gezielt vermieden.
Weitere Vorteile des Smart Charging sind die Vermeidung von Spannungsspitzen und Ladeabbrüchen, die die Batterieelektronik belasten können. Zudem kann das System die Ladezeiten so planen, dass die Batterie im optimalen Temperaturbereich geladen wird. Ein weiterer positiver Aspekt: Das intelligente Laden nutzt viele kleine Lade-"Hübe" statt weniger tiefer Ladezyklen, was den Zellstress reduziert und die Alterung verlangsamt.
Neben den technischen Vorteilen für die Batterie ergeben sich auch finanzielle Vorteile für den Nutzer. Beim unmittelbaren Laden wird keine Rücksicht auf die Strompreise genommen, während beim intelligenten Laden der Akku bevorzugt dann geladen wird, wenn die Preise aufgrund eines Überangebots besonders niedrig sind. Dies kann die Betriebskosten des Elektrofahrzeugs deutlich senken.
Professor Dirk Uwe Sauer von der RWTH Aachen, Experte für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik, sieht in der Technologie enormes Potenzial: "Intelligentes Laden und Vehicle-to-Grid sind Game Changer für die Elektromobilität. Die häufige Sorge, dass dies der Batterie schadet und eine vorzeitige Alterung bewirkt, kann damit aus dem Weg geräumt werden, wenn ein intelligentes Management eingesetzt wird" (Quelle4).
Herausforderungen auf dem Weg zum flächendeckenden Einsatz
Trotz der vielversprechenden Ergebnisse stehen der flächendeckenden Einführung des bidirektionalen Ladens noch erhebliche Hürden im Weg. Die größte technische Herausforderung besteht darin, dass für die Rückspeisung von Strom vom Auto ins Hausnetz oder ins öffentliche Stromnetz ein Wechselrichter erforderlich ist – entweder im Fahrzeug selbst oder in der Ladestation. Derzeit unterstützen jedoch nur wenige Elektroautos und Wallboxen diesen Prozess. Eine Nachrüstung ist zwar grundsätzlich möglich, in vielen Fällen aber mit hohen Kosten verbunden (Quelle4).
Neben den technischen Hürden gibt es auch regulatorische Unklarheiten. In Deutschland sind beispielsweise Fragen im Zusammenhang mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dem Energiewirtschaftsgesetz oder den Garantiebedingungen der Fahrzeughersteller noch nicht abschließend geklärt. Diese rechtlichen Unsicherheiten bremsen Investitionen in die Technologie und deren Verbreitung.
Johanna Bronisch, Leiterin der Energieinnovation am Innovations- und Gründungszentrum UnternehmerTUM, benennt die zentralen Hindernisse: "Im Falle des bidirektionalen Ladens sind die zentralen Hindernisse sicherlich der Mangel an Anreizen für Endkunden, fehlende oder heterogene technische Standards und die schlechte Verfügbarkeit interoperabler und erschwinglicher Hardware" (Quelle4). Sie fordert eine breitere Unterstützung aus der Politik, um diese Hürden zu überwinden.
Die Automobilindustrie steht derweil vor eigenen Herausforderungen. Während die Politik in Brüssel plant, ab 2035 nur noch emissionsfreie Neufahrzeuge zuzulassen, muss die Industrie den Umstieg auf Elektromobilität attraktiv gestalten. Steigende Strompreise für das Laden von Elektroautos könnten jedoch die Kaufbereitschaft potenzieller Kunden dämpfen (Quelle2). Hier könnte das bidirektionale Laden mit seinen Einsparmöglichkeiten und potenziellen Zusatzeinnahmen ein wichtiges Verkaufsargument werden.
Thomas Raffeiner, Gründer und CEO von The Mobility House, sieht in der Technologie große Chancen: "Durch unsere Erfahrung, die wir mit unterschiedlichen Automobilherstellern im Bereich der Vermarktung von Batterien erlangt haben, können wir maximale finanzielle Werte für unsere Kund:innen herausholen. Umso wichtiger ist es jetzt, die regulatorischen Weichen zu stellen, damit wir insbesondere in Deutschland den größtmöglichen Nutzen herausholen können" (Quelle4).
Sollten diese Herausforderungen überwunden werden, könnte das bidirektionale Laden ab 2030 flächendeckend verfügbar sein und einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. E-Auto-Besitzer könnten nicht nur von niedrigeren Strompreisen profitieren, sondern durch die Bereitstellung ihrer Fahrzeugbatterien als Energiespeicher zusätzliche Einnahmen von bis zu 600 Euro jährlich erzielen. In Kombination mit Solaranlagen ließe sich der eigene Energieverbrauch zudem optimieren und die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz reduzieren.
Im Überblick
- Technologie: Bidirektionales Laden (V2G)
- Zusätzliche Batteriealterung: 1,7 bis 5,8 Prozent in 10 Jahren
- Potenzielle jährliche Einnahmen: Bis zu 600 Euro
- Getestete Batteriekapazität: 53 kWh
- Getestete Batteriespannung: 335 Volt
- Getestete Zelltypen: Rundzellen, Pouchzellen, prismatische Zellen
- Simulationszeitraum: 10 Jahre
Stärken und Schwächen
- Geringe zusätzliche Batteriealterung von nur 1,7 bis 5,8 Prozent in zehn Jahren
- Potenzielle Einnahmen für E-Auto-Besitzer von bis zu 600 Euro jährlich
- Stabilisierung des Stromnetzes durch Nutzung von E-Autos als Energiespeicher
- Sinnvolle Nutzung von überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energien
- Moderne E-Auto-Batterien überdauern oft das Fahrzeug selbst
- Hohe Kosten für bidirektionale Wallboxen und kompatible Fahrzeuge
- Geringe Verfügbarkeit V2G-fähiger Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur
- Ungeklärte regulatorische Fragen bezüglich EEG und Energiewirtschaftsgesetz
- Fehlende technische Standards und Interoperabilität
- Mangelnde Anreize für Endkunden zur Investition in die Technologie