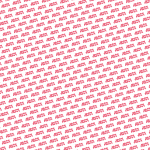Audi A6 Avant, BMW 5er Touring und Mercedes E-Klasse T-Modell: Drei Premium-Kombis zeigen ihre Stärken
Gute Fahrt
· 27.10.2025






Antriebstechnik und Effizienz im Detail
Die drei Oberklasse-Kombis setzen durchweg auf moderne Dieseltechnik mit Mildhybrid-Unterstützung, zeigen jedoch unterschiedliche Ansätze bei der Umsetzung. Der Ingolstädter Avant arbeitet mit dem komplexesten System: Ein Triebstranggenerator mit 230 Nm Drehmoment sitzt an der Ausgangswelle des Siebengang-Doppelkupplungsgetriebes und ermöglicht rein elektrisches Fahren in der Stadt. Zusätzlich übernimmt ein Riemenstartergenerator das Anwerfen des 2.0 TDI. Diese Dopplung führt allerdings zu Komplikationen - Getriebe und E-Antrieb verhakeln sich zuweilen, besonders beim Heranrollen an Ampeln. Das elektrische Fiepen des Antriebs ist deutlich hörbar und stört die Laufruhe.
Deutlich unkomplizierter agiert das Stuttgarter T-Modell. Der zwischen Motor und Neungang-Automatik integrierte Startergenerator kann den Selbstzünder anwerfen, Bremsenergie rekuperieren und mit bis zu 205 Nm beim Beschleunigen aushelfen, solange sich der Ladedruck des Turbos aufbaut. Rein elektrisches Fahren ist nicht möglich, dafür arbeitet das System ohne Hakeleien und überzeugt durch seine Zuverlässigkeit.
Der Münchener Touring nutzt ebenfalls einen Startergenerator, allerdings mit nur 25 Nm Unterstützung - zu wenig, um den Turbo-Übergang zu egalisieren. Stattdessen versucht der Zweiliter mit einer höheren Anfahrdrehzahl die Verzögerung zu verschleifen, wirkt dennoch deutlich matter als die Messwerte suggerieren. Beim Verbrauch liegen die Schwaben und Bayern gleichauf mit 4,9 Litern je 100 Kilometer, während der Ingolstädter 5,3 Liter benötigt - trotz seiner elektrischen Unterstützung.
Fahrverhalten und Dynamik
Die Unterschiede beim Fahrverhalten fallen gravierend aus. Das T-Modell dominiert diese Disziplin mit seinem Luftfahrwerk, das über Generationen Agilität erlernt hat, ohne den Komfort zu vernachlässigen. Der Oberklasse-Mercedes fühlt sich von Kurven angezogen, wirkt zentriert, liegt satt in der Hand und lenkt locker ein. Bodenwellen können ihn nicht aus der Spur bringen. Je schlechter der Belag, desto stärker saugt sich der 220 d an die Fahrbahn. Kehren nimmt er eng und ohne Kurbelei, obwohl der Testwagen ohne optionale Hinterachslenkung auskommen muss. Die breit gespreizte Automatik wechselt auf der Langstrecke in angenehm niedertourige Register und legt aufmerksam kürzere Übersetzungen ein, wenn Leistung gefordert wird.
Der Avant verfügt über ein solches Hinterachslenksystem und bindet es gut in den Fahrfluss ein. Sein aufpreispflichtiges Luftfahrwerk gefällt mit schluckfreudiger Federung samt firmer Dämpfung und gestattet eine anregende Linienwahl auch auf schlechten Straßen. Allerdings erreicht er nicht die saugende Spurführung des T-Modells und nicht dessen unbefangene Selbstverständlichkeit beim Tempoanziehen. Limitierend wirkt die Lenkung, die reserviert in ihrer Auskunftsfreudigkeit bleibt und durch leichtes Rütteln mitteilt, wenn die Vorderachse bei der Kombination aus Bremsen, Lenken und Einfedern an Kapazitätsgrenzen gelangt. Die Unterstützung arbeitet weniger kontinuierlich als vielmehr sprunghaft.
Auch der Touring hat Themen mit der Lenkung. Sie findet zwar zu einer harmonisch arbeitenden Unterstützung, nicht jedoch zum Gefühl fürs Gripniveau. Zudem fehlt eine gewisse Festigkeit um die Mittellage. Das Klein-klein der Kurven umkurvt der Große am liebsten, zumal dort häufig kariöse Fahrbahnbeläge anzutreffen sind, die sich durch Karosserie-Zittern ins Bewusstsein drängen. Besser funktioniert er auf Fernstraßen, wo er durch die Lande schwebt - etwas von der Wirklichkeit entkoppelt.
Raumangebot und Praktikabilität
Beim Platzangebot liefert der Mercedes die größte Raumausbeute und bietet das voluminöseste Kofferabteil - interessanterweise als Kürzester und Flachster den dreien. Sogar ein gut nutzbarer Stauraum findet sich dem Ladeboden, wo bei den Konkurrenten nur noch kleine Fächlein geblieben sind. Einzigartig im Umfeld montiert die Stuttgarter Marke Gurthöhenverstellungen sogar im Fond, während die Münchener seit Generationen darauf verzichten und damit ihren Kundenkreis einschränken.
Beim Touring passt immerhin das Gepäckrollo in den Unterboden - sehr praktisch. Leider hat er sich von seinem separat zu öffnenden Heckfenster verabschiedet. Irritierend schlecht fällt die Sicht aus dem Fahrzeug aus. Man sitzt tief, blickt auf eine hoch aufragende Armaturenlandschaft statt auf Hindernisse vor dem Auto und versucht, um die breiten A-Säulen herumzulinsen.
Der Avant muss mit einer gewissen Tradition leben: dem kleinen Gepäckabteil. Dieses Thema dürfte bei Interessenten bekannt sein - wer sich darauf einlässt, kauft bewusst die schicke Verpackung und weniger die Möglichkeit, besonders viel Inhalt hineinzuladen. Bei der Qualitätsanmutung irritiert die einstige Benchmark-Firma derzeit mit harten Kunststoffen in großer Zahl und rutscht ans untere Ende der Premium-Liga.
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
Die Bremsanlagen aller drei Fahrzeuge überzeugen mit hervorragenden Werten. Der Avant reißt sich geradezu aus seinem Vortrieb heraus und notiert 31,1 Meter bis zum Stillstand aus Tempo 100. Touring und T-Modell benötigen jeweils etwa einen Meter mehr - immer noch immens wenig. Die Ausstattung mit Assistenzsystemen ist vorbildlich, wobei die E-Klasse die meisten mitbringt. Allerdings tritt sich das Bremspedal irritierend weich.
Bei den Kosten entfernen sich die Testwagen weit vom Grundtarif und marschieren bei der E-Klasse stramm Richtung Sechsstelligkeit. Tröstlich: Das T-Modell verursacht im Vergleich die niedrigsten Festkosten und könnte noch günstiger sein, wenn es nicht jährlich zum Kundendienst samt Ölwechsel müsste. Deutlich günstiger ist der Touring bei den Wartungskosten, deutlich teurer dagegen bei der Vollkasko-Versicherung, wo ihn die Assekuranzen derzeit in eine hohe Typklasse einstufen. Immerhin gewährt die bayerische Marke drei Jahre Garantie, während Ingolstadt und Stuttgart nur zwei Jahre vertrauen.
Technische Daten im Überblick
- Motor: 2.0 TDI
- Leistung: 204 PS
- Antrieb: Quattro Allrad
- Getriebe: 7-Gang DKG
- Verbrauch: 5,3 l/100 km
- Tankvolumen: 60 Liter
- Reichweite: ca. 1.000 km
- Bremsweg 100-0 km/h: 31,1 Meter
- Mildhybrid-System: Triebstranggenerator
- E-Motor Drehmoment: 230 Nm
- Besonderheit: Rein elektrisches Fahren